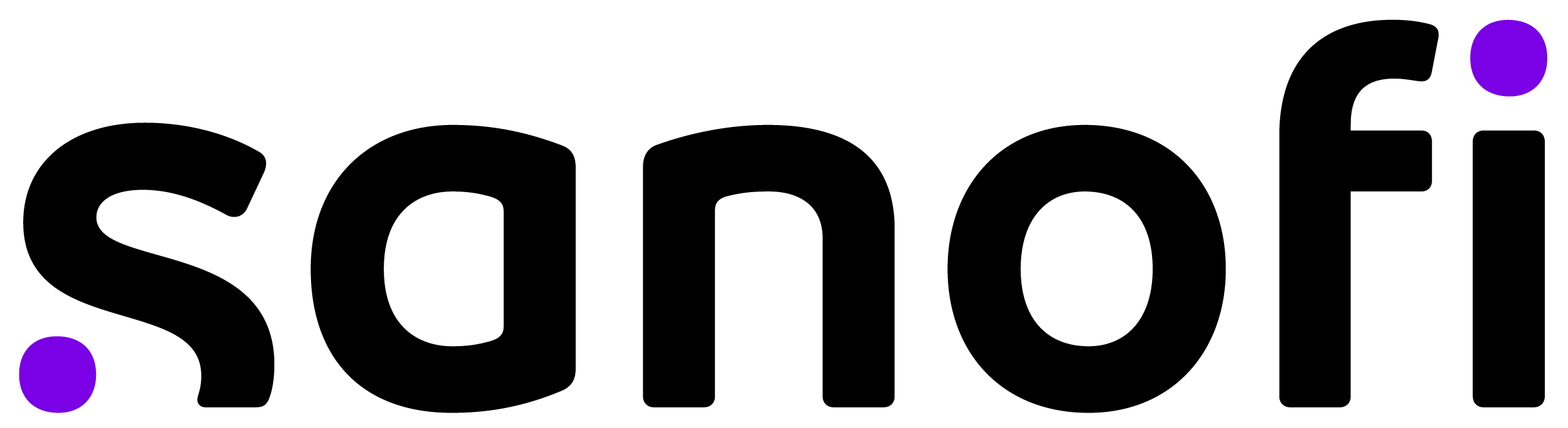OHRENERKRANKUNGEN UND TINNITUS
Säuglinge und Kleinkinder leiden oft unter starken Ohrenschmerzen. Besonders häufig sind Mittelohrentzündungen bei Kindern bis ins Schulalter, weil die kleine Ohrtrompete leicht verstopft. Bei Jugendlichen und Erwachsenen sind Entzündungen des äußeren Gehörgangs häufig die Ursache für Ohrenschmerzen. Hörstürze, Tinnitus und Schwerhörigkeit gehören zu den typischen Ohrenerkrankungen bei Erwachsenen.
Mittelohrentzündung
Das Mittelohr liegt zwischen dem Trommelfell und dem Innenohr. Die Ohrtrompete (Eustachische Röhre) verbindet das Mittelohr mit dem Nasen-Rachenraum. Weil bei Kindern die Eustachische Röhre noch sehr kurz ist, können bei Erkältungen Viren und Bakterien aus dem Rachenraum in das Mittelohr gelangen und dort eine Entzündung verursachen. Der Arzt untersucht das Ohr mit einem Ohrenspiegel. Eine Wölbung des Trommelfells deutet auf eine Flüssigkeitsansammlung dahinter: einen Paukenerguss. Abschwellende Nasentropfen können helfen, die Ohrtrompete wieder durchgängig zu machen, Antibiotika bei bakteriellen Infektionen.
Gehörgangs-Entzündung
Hinter plötzlichen Höreinbußen und Ohrenschmerzen kann ein Ohrschmalzpfropf und eine damit verbundene Entzündung des äußeren Gehörgangs stecken. Daher ist eine sorgfältige Ohrhygiene wichtig. Wattestäbchen sind für die Reinigung des Gehörgangs ungeeignet, denn sie können Entzündungen durch Bakterien, Viren oder Pilze verursachen. Bei einer Ohrenschmalz-Überproduktion empfiehlt es sich, ärztlichen Rat einzuholen. Übrigens: Das Ohrenschmalz ist wichtig. Es schützt das Mittelohr vor Infektionen. Eine Gehörgangs-Entzündung kann zudem entstehen, wenn regelmäßig Wasser in den Gehörgang gelangt – beim Schwimmen oder Tauchen. Es bildet sich ein feuchtes Milieu, in dem sich Krankheitserreger ansiedeln können.
Lärm schädigt das Gehör
Das Ohr ist an leise Dauergeräusche gewöhnt, jedoch nicht mit einer akustischen Dauerbelastung. Im Arbeitsschutz liegt die zumutbare Grenze für Dauerbeschallung (Tages-Lärmexpositionspegel) bei 85 Dezibel. Der Stapediusreflex schützt das Ohr vor plötzlichem Lärm. Bei sehr hohem Schalldruck zieht sich der Steigbügelmuskel im Mittelohr ruckartig zusammen und versteift so die Knöchelchenkette aus Hammer, Amboss und Steigbügel. Trotz dieses Reflexes sterben bei extrem lauten Geräuschen wie einer Explosion Sinneszellen ab. Bei langsam zunehmender Lautstärke funktioniert dieser Reflex nicht.
Schon ein Lärmpegel ab 85 Dezibel schädigt das Gehör dauerhaft. Bei lauter Musik oder starkem Lärm verkleben die Sinneshärchen in der Hörschnecke. Die Schmerzgrenze des Gehörs liegt normalerweise bei 120 Dezibel. Erst wenn es zu spät ist, wenn die Ohren dröhnen oder pfeifen, meldet das Gehör, dass es überlastet ist. Es gibt jedoch kein Warnsystem, das eine Schädigung abwenden könnte.
Wie entsteht Schwerhörigkeit?
Die zwei Formen der Schwerhörigkeit sind:
- Die Schallleitungsschwerhörigkeit betrifft die den Schall zuleitenden Teile des Ohres, das äußere Ohr und das Mittelohr.
- Schallempfindungsschwerhörigkeit entsteht hingegen im Innenohr, dem Hörnerv oder der im Gehirn verlaufenden Hörbahn.
Durch einen Hörtest mithilfe der Stimmgabel kann der Facharzt erkennen, welche der beiden Formen vorliegt und wie stark schwerhörig der Patient ist. Zudem gehören eine Anamnese (Krankengeschichte) und eine Ohrinspektion zur Diagnostik der Schwerhörigkeit. Weitere Messverfahren liefern genauere Informationen über die Qualität der Schallweiterleitung im Mittel- und Innenohr.
Was heißt Alters-Schwerhörigkeit?
Bei schleichender (Alters-)Schwerhörigkeit funktionieren die Haarzellen in der Hörschnecke nicht mehr so gut. Die Ursachen für schlechtes Hören im Alter sind noch nicht eindeutig geklärt. Manche Menschen hören im hohen Alter noch gut. Offenbar spielen hierbei sowohl die genetische Veranlagung als auch der Lebensstil eine Rolle. Lärm, Dauerstress, Medikamente, Stoffwechselerkrankungen, Durchblutungsstörungen sowie häufige Infektionen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich können die Hörfähigkeit vermindern.
Wie wird Schwerhörigkeit behandelt?
Hörgeräte können ein Hördefizit ausgleichen. Bei wiederkehrenden Infektionen oder schweren Hörstörungen, ist es manchmal sinnvoll, ein Cochlea-Implantat im Innenohr einzusetzen. Es übernimmt die Funktion der Hörschnecke und wandelt Schallwellen in elektrische Signale um. Ein Teil des Implantats wird in das Innenohr eingesetzt, ein anderer hinter der Ohrmuschel getragen. Der Hörnerv muss dazu intakt sein, um die empfangenen Signale in das Gehirn weiter zu leiten.
Wie werden Geschmacksstörungen behandelt?
Derzeit gibt es kaum erfolgreiche Therapiemaßnahmen. Häufig steht eine Behandlung der Grunderkrankung – zum Beispiel eine Infektion – im Vordergrund, so dass sich der Geschmackssinn nach Wochen bis Monaten wieder einstellt. Bei schweren Geschmacksstörungen gibt es die Möglichkeit, die Zunge mit einem lokalen Betäubungsmittel „einzuschläfern“. Bei Entzündungen der Mundschleimhaut kommen zum Teil Antibiotika zum Einsatz. Viele Geschmacksstörungen legen sich mit der Zeit ohne Behandlung. Zwei Drittel der Falschschmecker können ohne therapeutische Hilfe innerhalb eines Jahres wieder normal schmecken. In manchen Fällen kehrt der Geschmack spontan zurück.
Was ist ein Knalltrauma?
Ein kurzer, lauter Knall kann das Innenohr dauerhaft schädigen. Hält die Lärmbelastung länger als drei Millisekunden an (Explosionstrauma) entstehen Verletzungen des Trommelfells und der Gehörknöchelchen. Die Betroffenen spüren Druck und Taubheit in den Ohren. Manchmal kommt ein Ohrengeräusch hinzu. Ein Knalltrauma bedarf einer sofortigen Behandlung – beispielsweise mit durchblutungsfördernden Medikamenten.
Hörsturz
Ein Hörsturz entsteht plötzlich. Der Betroffene spürt Druck, manchmal auch Schwindel auf einem Ohr und kann in Sekundenbruchteilen auf einem Ohr kaum mehr hören. Hinzu kommt meist ein Ohrgeräusch. Die Ursachen für einen Hörsturz sind vielfältig. Dazu gehören Durchblutungsstörungen im Innenohr, Geschwülste, Stress sowie Verletzungen. Aufgrund der unklaren Ursachen, gilt der Hörsturz nicht als eigenständige Krankheit. Die spontane Selbstheilungsrate ist vergleichsweise hoch. Ihre Wahrscheinlichkeit sinkt jedoch nach der ersten Krankheitswoche1.
Gehörlosigkeit
Das Cochlea-Implantat (CI) kann auch Menschen helfen, die fast oder völlig gehörlos sind. In Deutschland leben etwa 80.000 Gehörlose [2]. Allerdings kann das Gehirn von Erwachsenen, die bereits lange gehörlos sind, die elektronischen Reize des Cochlea-Implantats nicht verarbeiten. Das Hören mit einem Implantat funktioniert anders als mit der natürlichen Hörschnecke, was zu einem veränderten Klang führt. Bei der elektrischen Stimulation werden mehrere Nervenzellen gleichzeitig angeregt. Der Implantat-Träger nimmt Geräusche daher verzerrter wahr als Gesunde. Nach dem Einsetzen wird der Sprachprozessor des Implantats auf das Gehör seines Trägers eingestellt. Wichtig ist, dass sich der Implantat-Träger durch regelmäßiges Sprech- und Hörtraining an die neue Hörqualität gewöhnt. Cochlea-Implantate können schon bei Säuglingen eingesetzt werden.
Tinnitus
Tinnitus oder das Tinnitus-Syndrom ist eine Fehlsteuerung von Nervenzellen und keine Erkrankung.
TINNITUS
Zur Ursache von Tinnitus gibt es mehrere Hypothesen:
1. Tinnitus als Phantomgeräusch
Das Ohr ist an bestimmte Hintergrundgeräusche gewöhnt. Daher gehört ein gewisser Geräuschpegel zum Normalzustand des Hörens. Fehlen diese Geräusche plötzlich, beispielsweise während einer vorübergehenden Hörstörung, konzentriert sich die Wahrnehmung auf die fehlenden Geräusche. Mit den Geräuschen kehrt auch das Gehör in seinen Normalzustand zurück: Neues und Wichtiges gelangt in das Bewusstsein. Die hemmenden Systeme im Gehirn blockieren übrige Geräusche.
Nehmen die Sinneszellen jedoch weiterhin keine Geräusche wahr, reguliert das Hörsystem den Input-Pegel hoch. Dieser Verstärkereffekt kann zu Rückkopplungsschwingungen führen. Das Ohr produziert einen eigenen Ton. In der Folge entsteht ein Phantomgeräusch – ein Brummen, Rauschen, Pfeifen, Zirpen oder Klopfen, als Dauerton oder in Intervallen 1.
2. Tinnitus als nicht mehr unterdrücktes Grundgeräusch
Eine zweite Hypothese geht davon aus, dass jeder Mensch ein Grundgeräusch in der Hörwahrnehmung besitzt, welches das Gehirn unterdrückt. Funktioniert diese Unterdrückung des Gehirns nicht mehr, wird das Geräusch hörbar. Demnach entsteht Tinnitus im Gehirn, weil sich in der Hörbahn Nervenimpulse bilden, die normalerweise von äußeren Schallquellen ausgelöst werden 1.
3. Tinnitus als Folge von Ohrerkrankungen
Ein Tinnitus kann plötzlich als Folge unterschiedlicher Ohrerkrankungen entstehen, beispielsweise nach einer Mittelohrentzündung, eines Lärmtraumas, eines Fremdkörpers im Gehörgang oder bei Schwerhörigkeit. Zudem können Funktionsstörungen der Kiefergelenke ein Ohrgeräusch auslösen 1. Nach Schätzungen leiden in Deutschland etwa 1,5 Millionen Menschen mittelgradig bis unerträglich unter Tinnitus 3.
Wie wird Tinnitus behandelt?
Die Basistherapie besteht aus einem Tinnitus-Counseling (Beratung). Zu anderen Behandlungen wie hörtherapeutische Maßnahmen, Audiotherapie oder Hörgeräte zeigen sich die Experten uneins und sprechen keine eindeutige Therapie-Empfehlung aus. 4
Letzte Aktualisierung: 02.08.2019
REFERENZEN
[1] Modifiziert nach: Gürkov, R., BASICS Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 4. Auflage 2016, Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH, ISBN: 3437421794, Zugriffsdatum 20. Mai 2018: https://shop.elsevier.de/basics-hals-nasen-ohren-heilkunde-9783437421792.html
[2] Deutscher Gehörlosen-Bund e.V., Zugriffsdatum 20. Mai 2018: http://www.gehoerlosen-bund.de/faq/geh%C3%B6rlosigkeit
[3] Deutsche Tinnitus-Liga e.V., Zugriffsdatum 20. Mai 2018: https://www.tinnitus-liga.de/pages/tinnitus-sonstige-hoerbeeintraechtigungen/tinnitus.php
[4] S3-Leitlinie 017/064: Chronischer Tinnitus, AWMF-Register Nr. 017/064, Stand 02/2015, Zugriffsdatum 21. Mai 2018: http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/017-064l_S3_Chronischer_Tinnitus_2015-02.pdf